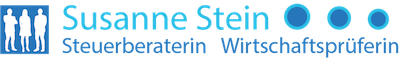Überblick
Elektronische Rechnungen sind im B2B-Bereich zukünftig verpflichtend. Entsprechende umsatzsteuerrechtliche Regelungen sind im Wachstumschancengesetz vom 27.3.2024 (BGBl 2024 I Nr. 108) enthalten. Das BMF hat am 15.10.2024 ein Einführungsschreiben zur E-Rechnung veröffentlicht. Seit dem 19.11.2024 gibt es außerdem einen Frage-Antwort-Katalog (FAQ). Wir geben einen Überblick über die neuen Regelungen zur E-Rechnung.
Wer ist betroffen?
Die Verpflichtung, eine elektronische Rechnung im o.g. Sinne auszustellen, betrifft nur Leistungen zwischen Unternehmern (B2B). Zudem müssen leistender Unternehmer und Leistungsempfänger im Inland[1] ansässig sein.
Lt. Finanzverwaltung reicht es bei Dauerschuldverhältnissen (z. B. Mietverhältnis) aus, wenn für den ersten Teilleistungszeitraum eine E-Rechnung ausgestellt wird und der entsprechende Vertrag als Anhang beigefügt wird oder sich aus dem sonstigen Inhalt klar ergibt, dass es sich um eine Dauerrechnung handelt (vgl. BMF, Schreiben v. 15.10.2024, Tz. 45).
Auch Vereine, soweit sie unternehmerisch tätig sind, sind von der E-Rechnung betroffen (siehe hierzu die FAQ des BMF (Frage 5; Stand: 19.11.2024).
Ab wann gilt die Verpflichtung?
Die grundsätzliche Verpflichtung zur elektronischen Rechnungstellung gilt ab 1.1.2025. Angesichts des zu erwartenden hohen Umsetzungsaufwandes für die Unternehmen hat der Gesetzgeber jedoch Übergangsregelungen (§ 27 Abs. 38 UStG n. F.) für die Jahre 2025 bis 2027 vorgesehen. Diese sind in der vom Bundestag verabschiedeten Gesetzesfassung nochmals etwas großzügiger als im Regierungsentwurf:
» Bis Ende 2026…
dürfen für in 2025 und 2026 ausgeführte B2B-Umsätze weiterhin Papierrechnungen übermittelt werden. Auch elektronische Rechnungen, die nicht dem neuen Format entsprechen, bleiben in diesem Zeitraum zulässig, allerdings ist hierfür (wie bisher) die Zustimmung des Rechnungsempfängers erforderlich (§ 27 Abs. 38 Nr. 1 UStG n. F.).
» Bis Ende 2027…
dürfen für in 2027 ausgeführte B2B-Umsätze weiterhin Papierrechnungen übermittelt werden. Auch elektronische Rechnungen, die nicht dem neuen Format entsprechen, bleiben in diesem Zeitraum zulässig; wie in 2025 und 2026 (s. o.) ist hierfür die Zustimmung des Rechnungsempfängers erforderlich; zusätzliche Voraussetzung ist allerdings, dass der Rechnungsaussteller einen Vorjahresumsatz von max. 800.000 EUR hat (§ 27 Abs. 38 Nr. 2 UStG n. F.).
Unternehmer, deren Vorjahresumsatz (2026) diese Grenze überschreitet, haben aber noch die Möglichkeit, Rechnungen auszustellen, die mittels elektronischem Datenaustausch (EDI-Verfahren) übermittelt werden. Dies gilt für Umsätze, die in 2026 bzw. 2027 ausgeführt wurden, auch dann, wenn keine Extraktion der erforderlichen Informationen in ein Format erfolgt, das der europäischen Norm entspricht oder mit dieser kompatibel ist.
Sonderfall: Voraus- oder Anzahlungsrechnungen
Bei vor Ausführung einer Leistung vereinnahmten (Teil-)Entgelten kann nach Ausführung der Leistung grds. mit einer Endrechnung (Abschn. 14.8 Abs. 7-10 UStAE) oder einer Restrechnung (Abschn. 14.8 Abs. 11 UStAE) abgerechnet werden. Da die Anforderungen an eine Endrechnung aktuell noch nicht im strukturierten Teil einer E-Rechnung darstellbar sind, bietet sich in diesen Fällen eine Restrechnung an. Die Finanzverwaltung beanstandet es jedoch nicht, wenn stattdessen in einer bis zum 31.12.2027 als E-Rechnung ausgestellten Endrechnung ein Anhang i. S. v. Abschn. 14.8 Abs. 8 Nr. 2 UStAE als unstrukturierte Datei in der E-Rechnung enthalten ist. Der gesonderte Versand einer besonderen Zusammenstellung (Abschn. 14.8 Abs. 8 Nr. 3 UStAE) ist dagegen bei einer E-Rechnung nicht möglich (Tz. 47, 48).
» Ab 2028…
sind die neuen Anforderungen an die E-Rechnungen und ihre Übermittlung dann zwingend einzuhalten. Damit werden auch die Voraussetzungen geschaffen für das im Koalitionsvertrag vorgesehene Meldesystem bzw. die EU-seitig geplanten ViDA-Maßnahmen. Um die Ausgestaltung des strukturierten elektronischen Formats der elektronischen Rechnungen im Verordnungswege näher bestimmen zu können, wurde in § 14 Abs. 6 UStG n. F. eine neue Ermächtigung für das BMF aufgenommen.
Was gilt für Rechnungsempfänger?
Die neue E-Rechnungspflicht gilt wie dargestellt grundsätzlich ab 1.1.2025. Unabhängig davon, ob ein inländisches Unternehmen als Rechnungsaussteller elektronische Rechnungen entsprechend den neuen Anforderungen im strukturierten Format ausstellt (und demnach die o.g. Übergangsregelungen nicht in Anspruch nimmt), müssen inländische unternehmerische Rechnungsempfänger also bereits ab 1.1.2025 in der Lage sein, elektronische Rechnungen nach den neuen Vorgaben empfangen.
Der Rechnungsempfänger hat kein Anrecht auf Ausstellung einer sonstigen Rechnung durch den Rechnungsaussteller, auch wenn er die Annahme einer E-Rechnung verweigert bzw. technisch hierzu nicht in der Lage ist.
Anders als bisher ist die elektronische Rechnungstellung auch nicht an eine Zustimmung des Rechnungsempfängers geknüpft; diese ist nur noch für elektronische Rechnungen erforderlich, die nicht den neuen Vorgaben entsprechen bzw. in den Fällen, in denen keine E-Rechnungspflicht besteht (z. B. bei bestimmten steuerfreien Umsätzen oder Kleinbetragsrechnungen).
Bei Rechnungen an Endverbraucher (B2C) bleibt deren Zustimmung Voraussetzung für die elektronische Rechnungstellung.
Wichtig
StB Prof. Radeisen weist darauf hin, dass auch Unternehmer, die selbst nur steuerfreie Leistungen erbringen (z.B. Wohnungsvermieter, Ärzte) künftig in der Lage sein müssen, elektronische Rechnungen im strukturierten Format empfangen und archivieren zu können. Dasselbe dürfte u.E. auch für Betreiber von PV-Anlagen gelten, unabhängig davon, ob sie die Kleinunternehmerregelung (§ 19 UStG) in Anspruch nehmen oder nicht.
Ursprünglich wollte die Bundesregierung die Unternehmen noch vor Ende 2024 mit einem kostenlosen Angebot zum Erstellen und zur Visualisierung elektronischer Rechnungen unterstützen. Dies war insbesondere für Unternehmen gedacht, die nur wenig bis gar keine B2B-Umsätze ausführen oder überhaupt nur geringfügig tätig sind. Nach einer Prüfung durch das BMF wurde jedoch entschieden, dass ein solches Tool (in Konkurrenz zur Privatwirtschaft) nicht zur Verfügung gestellt werden kann.
Die neue gesetzliche Regelung enthält keine Vorgaben zum Übermittlungsweg von elektronischen Rechnungen. Für den Empfang einer elektronischen Rechnung reicht daher auch ein E-Mail-Postfach aus (Tz. 40). Dabei muss es sich nicht zwingend um ein gesondertes E-Mail-Postfach allein für den Empfang von E-Rechnungen handeln, was sich aber dennoch anbietet.
Neben dem Versand per E-Mail kommen auch die Bereitstellung der Daten mittels elektronischer Schnittstelle, der gemeinsame Zugriff auf einen zentralen Speicherort innerhalb eines Konzernverbundes oder die Möglichkeit des Downloads über ein Internetportal in Betracht (vgl. BMF, Schreiben v. 15.10.2024, Tz. 36).
Nicht in jedem Fall ist eine E-Rechnung im o.g. Sinne verpflichtend. So können z.B. Kleinbetragsrechnungen (§ 33 UStDV) weiterhin als „sonstige Rechnungen“ im o.g. Sinne übermittelt werden, also z.B. in Papierform. Gleiches gilt für Fahrausweise (§ 34 UStDV). Beide können aber auch als E-Rechnung ausgestellt und übermittelt werden, wenn der Empfänger zustimmt (formlos, ggf. auch konkludent).
Eine viel diskutierte Frage im Vorfeld zur Einführung der E-Rechnung war, ob auch für Barkäufe von Unternehmern über 250 EUR E-Rechnungen ausgestellt werden müssen. Das BMF stellt hierzu in seinen FAQ (Frage 10; Stand: 19.11.2024) klar, dass mangels gesetzlicher Ausnahmeregelung auch hier eine E-Rechnung vorgeschrieben ist. Es biete sich in diesen Fällen (z. B. Geschäftsessen im Restaurant, Einkauf im Baumarkt) an, dass zunächst vor Ort eine sonstige Rechnung (z. B. Kassenbeleg) ausgestellt wird, die dann nachträglich durch eine E-Rechnung berichtigt wird. Es wird sich zeigen, ob dies eine praxistaugliche Lösung ist, zumal der leistende Unternehmer dafür die E-Mail-Adresse des Rechnungsempfängers ermitteln muss. Hier wäre eine Vereinfachungsregelung sicher hilfreich gewesen.
Vorsteuerabzug
Die Finanzverwaltung äußert sich in ihrem Einführungsschreiben v. 15.10.2024 auch zum Vorsteuerabzug (Tz. 55-59): In Fällen, wo eine E-Rechnung verpflichtend ist, erfüllt auch nur diese die Anforderungen an eine ordnungsgemäße Rechnung. Eine sonstige Rechnung (z. B. durch Kassensystem erzeugte Rechnung) berechtigt danach dem Grunde nach nicht zum Vorsteuerabzug. Sie kann aber durch eine E-Rechnung berichtigt werden, die auf die ursprüngliche Rechnung spezifisch und eindeutig Bezug nimmt, und dadurch zum Ausdruck bringt, dass es sich um eine berichtigte Rechnung handelt. Auch hier ist eine Rückwirkung auf den Zeitpunkt der Ausstellung der sonstigen Rechnung möglich.
Auch ohne Rechnungsberichtigung ist nicht alles verloren: Die Finanzverwaltung will einen Vorsteuerabzug zulassen, sofern sie über alle Angaben verfügt, um die materiellen Voraussetzungen zu prüfen. Die Angaben aus einer sonstigen Rechnung sind hier als mögliche objektive Nachweise zu berücksichtigen.
Aufbewahrung
Die Ausführungen des BMF zur Aufbewahrung von E-Rechnungen fallen im Einführungsschreiben v. 15.10.2024 recht knapp aus (Tz. 60, 61): Der strukturierte Teil einer E-Rechnung muss danach in seiner ursprünglichen Form und unveränderbar aufbewahrt werden. Das Gleiche gilt für Aufzeichnungen, die für die Besteuerung von Bedeutung sind (z. B. Buchungsvermerke), und in einem zusätzlichen übersandten Dokument (z. B. Bildteil einer hybriden Rechnung) enthalten sind.
Entscheidend ist, dass die Finanzverwaltung die aufbewahrten E-Rechnungen (bzw. den strukturierten Teil) maschinell auswerten können muss.
Im Übrigen wird auf das BMF-Schreiben v. 28.11.2019, BStBl 2019 I S. 1269, Rz. 130 ff. verwiesen.
Ausblick
An der elektronischen Rechnungstellung führt kein Weg vorbei, zumal die Effizienzvorteile der automatischen Verarbeitung strukturierter Rechnungsdaten auf der Hand liegen. Im öffentlichen Auftragswesen sind elektronische Rechnungen in diesem Sinne bereits verpflichtend und auch im privaten Sektor erwarten immer mehr Unternehmen von ihren Geschäftspartnern, dass diese in der Lage sind, elektronische Rechnungen zu empfangen und zu versenden. Insofern wächst der Umstellungsdruck unabhängig von den Zeitplänen der nationalen oder EU-seitigen Gesetzgebung. Da Zeit- und Ressourcenaufwand für die Umstellung je nach Unternehmensgröße und Systemlandschaft erheblich sein können, empfiehlt es sich, entsprechende Projektstrukturen zeitnah zu implementieren, sofern das noch nicht geschehen ist. Das erleichtert eine fristgerechte Umsetzung, sobald die rechtlichen und technischen Details endgültig feststehen